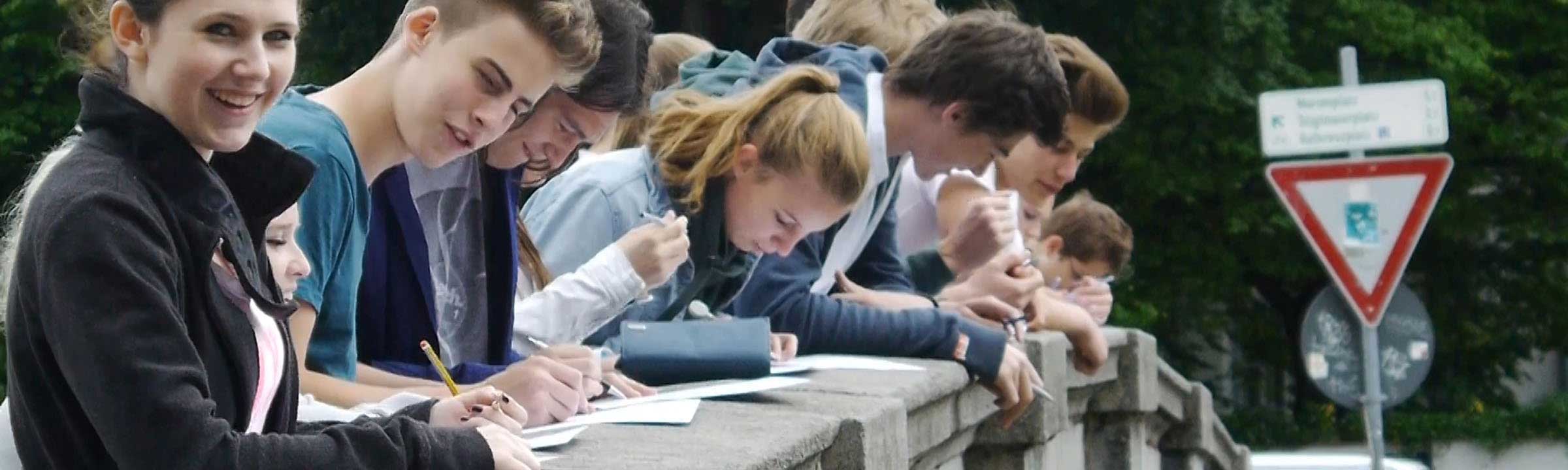Raum zum selbstständigen Handeln

Der Wandel der gesellschaftlichen Anforderungen an die Schule führt zu einem neuen Leistungsprofil. Stoffvermittlung und reines Faktenwissen allein reichen nicht mehr aus, sondern müssen mit dem Erwerb von Fähigkeiten und Fertigkeiten verknüpft sein. Das bedeutet für den Unterricht, dass er dem selbstständigen Handeln des Schülers Raum gibt. Raum zum Formulieren eigener Ideen und Strategien, um ein Problem zu lösen. Raum zur Selbstorganisation und zur Absprache im Team. Raum dazu, eigenverantwortlich und leistungsbewusst zu arbeiten und sich an eigenen Zielen zu orientieren.

Wir geben den Schülern aber auch persönliche Hilfestellungen bei der Bewältigung eines Lernwegs, der bei weitem mehr abfordert als den Erwerb von Faktenwissen. Sich selbst Ziele zu setzen und beim Lernen daran zu orientieren, kann nur gelingen, wenn man seinen eigenen Lernprozess reflektiert. Dies geschieht bei uns mit Hilfe regelmäßiger Feedbackgespräche, die im Lernatelier zentraler Bestandteil der Mentorentätigkeit sind.
Durch die Zusammenarbeit mit zahlreichen Kooperationspartnern – anderen Schulen, sozialen, wissenschaftlichen und kulturellen Einrichtungen, Unternehmen und Vereinen – öffnen wir unsere Schule und nutzen neue Impulse von außen, die unsere Schüler in ihrer sozialen Kompetenz stärken.
Themenprojektwoche - was wirklich zählt!
(…) "Wir leben in einer Welt, in der die Dinge, die leicht zu unterrichten und zu testen sind, auch leicht digitalisiert und automatisiert werden können. Die Welt belohnt uns nicht mehr allein für das, was wir wissen – Google weiß ja schon alles –, sondern für das, was wir mit dem, was wir wissen, tun können. In der Zukunft wird es darum gehen, die künstliche Intelligenz von Computern mit den kognitiven, sozialen und emotionalen Fähigkeiten und Werten von Menschen zu verknüpfen. Es werden unsere Vorstellungskraft, unser Bewusstsein und unser Verantwortungsgefühl sein, die uns helfen werden, Technologien zu nutzen, um die Welt zum Besseren zu gestalten. Erfolg in der Bildung bedeutet nicht nur das Lernen von Sprachen, Mathematik oder Geschichte, sondern auch die Entwicklung von Identität, Handlungsfähigkeit und Sinnhaftigkeit. Es geht darum, Neugier und Wissensdurst zu wecken, den Intellekt für Neues zu öffnen. Es geht um Mitgefühl, darum, die Herzen zu öffnen. Und es geht um Mut, um die Fähigkeit, unsere kognitiven, sozialen und emotionalen Ressourcen zu mobilisieren. Das werden auch unsere besten Mittel gegen die größten Bedrohungen unserer Zeit sein: die Ignoranz – der verschlossene Verstand, der Hass – das verschlossene Herz – und die Angst – der Feind von Handlungsfähigkeit." (…)
Quelle: https://www.oecd.org/education/2030-project/contact/OECD_Lernkompass_2030.pdf, aufgerufen am 01.09.2022
Uns als Schule geht es in allen Phasen des Lehrens und Lernens um diese wichtigen Kompetenzen:
Projektlernen erweitert persönliche und fachliche Kompetenzen mit Themen, die bewegen.
Wir wissen, dass Schüler- und Erwachsenenthemen nicht immer matchen. Uns allen ist aber wichtig, Themen zu wählen, die im Leben bedeutend sind und auch Raum für Entwicklung lassen. Das ermöglicht den Schülerinnen und Schülern, ihre eigenen Lernwege zu entdecken und auszuprobieren. Durch die Anwendung bereits erworbenen Wissens, mit Hilfe von Skills und eigenen Haltungen werden neue Inhalte und Meinungen kennengelernt und sich darüber ausgetauscht. So entsteht Raum für differenziertes Lernen. Persönliche Kompetenzen werden ebenso im Rahmen der Teamarbeit (2-4 Schülerinnen und Schüler) gestärkt.
Im Jahresplan fest verankert.
Folgende Elemente finden regelmäßig statt:
- eine Kick-Off-Veranstaltung zu Beginn des Schuljahres (Jahrgangsstufen 9 und 10)
- je eine Woche Projekt mit ausgewählten Fächern zu einem selbstgewählten thematischen Schwerpunkt passend zum vorgegebenen Leitthema (zweimal in Jahrgangsstufe 9, einmal in Jahrgangsstufe 10 pro Schuljahr)
- je eine Präsentation der Ergebnisse
Das erwarten wir:
Schule ist ein Raum des Lernens, das heißt es kann ausprobiert und aus Fehlern gelernt werden, um dann etwas besser zu machen und Erfolg zu erleben. Deswegen ist Feedback während und am Ende des Projekts zentral. Das Ergebnis der Themenprojektwoche kann im 2. Durchlauf in Jahrgangsstufe 9 und in der Jahrgangsstufe 10 für ein Fach im Rahmen einer freiwilligen kleinen Leistungserhebung benotet werden. Die Schüler entscheiden sich bei der Themenfestlegung dazu verbindlich.
Das Impulsheft
Das Impulsheft dient als Organisationshelfer und leitet wie ein roter Faden durch die Themenprojektwoche. Deshalb ist das Impulsheft ein wesentlicher Bestandteil und für alle verpflichtend auszufüllen!
Zeige deine Stärken!
Wichtig ist uns die Möglichkeit, Talente und Stärken während der Erarbeitung und der Präsentation auszubauen. Das „Produkt“ wird im Rahmen eines „Gallery Walks“ organisiert, so dass sich die Schulfamilie von der Kreativität, den Stärken und Talenten der Gruppen überzeugen kann.
Wissenschaftswoche an den Nymphenburger Schulen
Die Wissenschaftswoche im neunjährigen Gymnasium zielt darauf ab, Lust und Neugierde auf wissenschaftliches Arbeiten zu wecken und dabei wichtige Kompetenzen zu stärken. Durch das fächerübergreifende Arbeiten sollen die Schülerinnen und Schüler eine multiperspektivische Sicht auf ein Rahmenthema gewinnen.
Der organisatorische Ablauf ist sehr eng an unsere Themenprojektwoche in der Jahrgangstufe 9 und 10 angelehnt und fördern dadurch das nachhaltige Lernen bzw. den Kompetenzerwerb:
- Kick-Off: Einführung in die Organisation und Themeninput
- Themenfindung: Schülerinnen und Schüler entwickeln mit Unterstützung einer Lehrkraft ihre spezifischen Fragestellungen.
- Arbeitsphase: Start der Arbeitsphase mit einem gemeinsamen Auftakt und Impuls
- Feedback: Regelmäßige Rückmeldungen zu Zwischenergebnissen
- Präsentation: Vorstellung der Ergebnisse und Produkte vor Lehrkräften und Mitschülern
- Abschluss: Abschlussfeedback und Evaluation der gesamten Woche
Leitthemen waren beispielsweise "Meilensteine" und "Metamorphosen". Die Schülerinnen und Schüler bilden selbstständig kleine Gruppen und können ihre Themen im Rahmen des Leitthemas in Absprache mit der betreuenden Lehrkraft frei wählen. Sie haben dafür 3-4 Wochen Zeit und sollen aktiv eigene Ideen in die Themenfindung einbringen.
Beispiele zum Leitthema „Meilensteine“:
- CDR-Methoden (Kooperation LMU Department of Geography)
- Klimawandel (Kooperation LMU Department of Geography)
- Vegetarisches Mensaessen
- Meilensteine in der Luft- und Raumfahrt
- Erfindungen in der Physik
- Frauenrechte
- Raketentechnik
- Organspende
- Die erste Südpolexpedition
- Wie effektiv und nachhaltig sind die aktuellen Hochwasserschutzmaßnahmen in Bayern im Hinblick auf den Schutz von Bevölkerung und Infrastruktur sowie die Anpassung an den Klimawandel?
Die Vorstellung der einzelnen Ergebnisse markiert das Ende der Wissenschaftswoche. Der gesamte Prozess wird qualitativ bewertet und im Jahreszeugnis gewürdigt.